Buenos Aires (AT) – Laut einer Langzeitstudie des Deutschen Digitalverbands herrscht in Deutschland ein gravierender Mangel an Fachkräften für Informationstechnologie (IKT), der bis 2040 auf 663.000 ansteigen wird, wenn nicht entschlossen gehandelt wird. Bitcom.
Derzeit können 149.000 offene Stellen in diesem Sektor nicht besetzt werden, und dieser Mangel wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Programmierern, Systemadministratoren und anderen Spezialisten in den kommenden Jahren voraussichtlich noch zunehmen.
Bis 2040 müssen im IKT-Sektor schätzungsweise 1,92 Millionen Stellen besetzt werden, das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften wird jedoch auf nur 1,26 Millionen geschätzt, was eine erhebliche Lücke darstellt.
Ralf Wintergerst, Präsident des Bitkom, betont, dass es neben diesen Zahlen auch tausende offene Stellen mit EDV-Schwerpunkt in Verwaltungen, Schulen und wissenschaftlichen Einrichtungen gibt: „Der sich seit Jahren verschärfende Mangel an IKT-Fachkräften wirkt sich auf die IT-Branche aus.“ Das ganze Land und ein gewaltiger Stopp der Digitalisierung sind notwendig.“
Der zunehmende Mangel an IKT-Kompetenzen bedeute einen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung, Wachstum und Wohlstand, sagte Wintergerst. „Ohne IT-Fachkräfte riskiert Deutschland seine digitale Zukunft.“
Schritte, um aus der Krise herauszukommen



Der Branchenverband führte jedoch aus, dass diese Lücke durch eine Reihe von Gegenmaßnahmen verringert werden könne. Dazu gehört die Erleichterung des Einstiegs von rund 108.000 zusätzlichen Fachkräften bis 2040 durch die Rekrutierung von mehr Studierenden und Auszubildenden, die Förderung von Mädchen und Frauen für den Einstieg in IKT-Bereiche sowie die Senkung der Schulabbrecherquoten im Informatikbereich.
Um dieses Ziel zu erreichen, schlägt Wintergerst vor, dass Informatik ab dem ersten Schuljahr in allen Bundesländern ein Pflichtfach sein sollte und dass mehr Studienplätze in den Bereichen Informatik, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz geschaffen werden müssten.
Eine weitere vorgeschlagene Strategie ist die Bindung älterer Arbeitnehmer über das Rentenalter hinaus, wodurch bis 2040 zusätzliche 68.500 Fachkräfte entstehen könnten. Darüber hinaus könnten weitere 129.500 Fachkräfte hinzukommen, wenn auch Menschen aus anderen Berufen der Übergang in die Computerbranche ermöglicht und erleichtert wird.
Allerdings würden alle in Deutschland umgesetzten Maßnahmen nicht ausreichen, sagte Wintergerst und schlug daher vor, mehr als 320.000 Fachkräfte aus dem Ausland einzustellen: „Diese Lücke können wir nicht alleine schließen.“
Um die notwendige Zuwanderung zu fördern, schlug er vor, die Wirkung der Gesetze zur Fachkräfteeinwanderung durch Maßnahmen wie die Standardisierung und Digitalisierung der Einwanderungsverfahren zu stärken.
Bitkom empfahl außerdem, die Ausländerbehörden in „Zulassungsagenturen“ umzuwandeln und eine internationale Marketingkampagne durchzuführen, um Deutschland als attraktives Ziel für IT-Fachkräfte zu bewerben. „Diese Menschen werden auf der ganzen Welt angesprochen. „Deutschland muss eine offene, tolerante und freie Gesellschaft bleiben, wenn wir ihre Aufmerksamkeit erregen wollen“, betonte Wintergerst.
Digitalisierung in Deutschland: eine regionale Herausforderung
Laut einem Bitkom-Bericht befindet sich Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern der Europäischen Union auf einem durchschnittlichen Digitalisierungsgrad. Allerdings gibt es zwischen den Bundesländern eklatante Unterschiede.
In Ostdeutschland stehen sie vor erheblichen Digitalisierungsproblemen. „Kein Staat macht alles richtig oder falsch“, sagte Ralf Wintergerst bei der Vorstellung der Forschung. Am stärksten betroffen sind Gebiete mit einer schwachen Wirtschaftsstruktur. Generell könne man „mit der Digitalisierung in Deutschland nicht zufrieden sein“, sagte der Bitkom-Präsident.
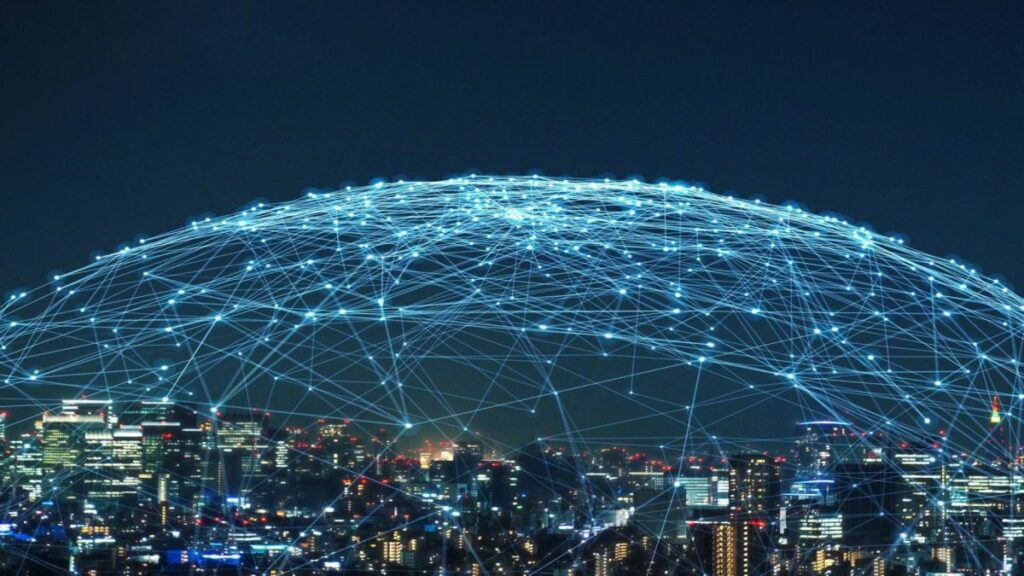
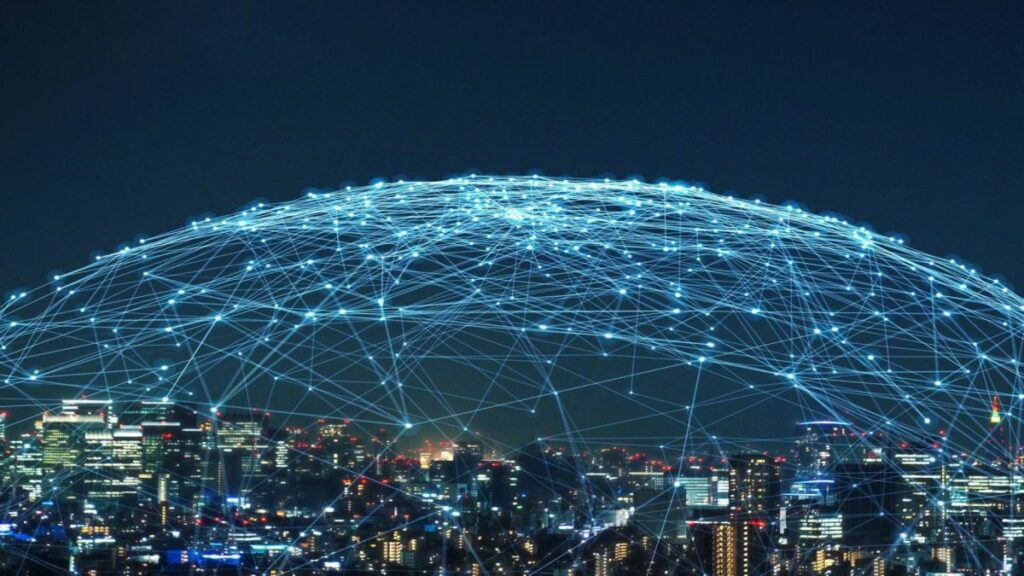
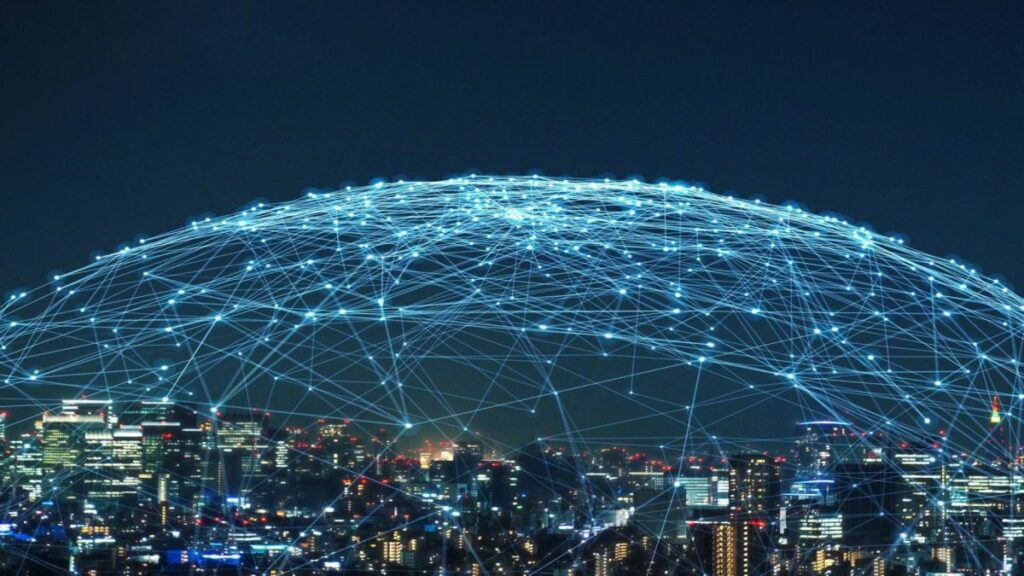
Der regionale Digitalisierungsindex des Bitkom bewertet 26 Indikatoren in vier Kategorien, basierend auf einer Befragung von 16 Landesverwaltungen und 5.600 Personen sowie verschiedenen amtlichen Statistiken und Studien Dritter.
Gemessen werden Aspekte wie die Anzahl digitaler Unternehmen, die Verfügbarkeit digitaler Verwaltungsdienste und die digitale Kompetenz der Menschen. Allerdings liegt in einer Kategorie der Osten vorne.
Berlin und Hamburg mit den besten Ergebnissen
Bei der Digitalisierung schnitten die Stadtstaaten Berlin und Hamburg sowie Bayern, Baden-Württemberg und Hessen am besten ab und schlugen Länder wie Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz.
Digitalisierung der Verwaltung: noch im Rückstand
Bei der Verwaltungsdigitalisierung kam es beim Bitkom zu erheblichen Verzögerungen. Obwohl Hamburg mit 64 von 100 Punkten vorne liegt, liegen das Saarland (33,2 Punkte) und Bremen (34 Punkte) auf den Schlusslichtern.
Die Einhaltung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) ist ein zentraler Indikator. Hamburg hat 45 % der erforderlichen Punkte erreicht, während das Saarland und Sachsen-Anhalt nur 29 % erreichen. Fehlende Digitalisierung in der Verwaltung verursacht zusätzliche Kosten, da die Akten manuell erstellt werden müssen.
In der Ostregion gibt es wenig digitale Wirtschaft
Bei der „Digitalen Wirtschaft“, die die Zahl der IT-Auszubildenden und der Unternehmen der Informations- und Kommunikationsbranche umfasst, liegt Berlin leicht vor Hamburg, während die östlichen Bundesländer auf dem letzten Platz liegen.
Mecklenburg-Vorpommern ist infrastrukturell sehr schwach und hat nur wenige Startups, im vergangenen Jahr gab es nur 19 Neugründungen.
Bei der digitalen Infrastruktur (5G, Glasfaser und Gigabit) liegen Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin an der Spitze, während die fünf östlichen Bundesländer und das Saarland die Schlusslichter sind. Thüringen weist den schlechtesten Glasfaserausbau auf.
Digitaler Wettbewerb im Osten
In der „Digitalen Gesellschaft“ liegt Mecklenburg-Vorpommern aufgrund der digitalen Kompetenz seiner Bevölkerung an der Spitze, angetrieben durch das Pflichtfach „Informatik und Medien“ ab der fünften Klasse an allen Schulen. Dies könnte dazu beitragen, den Fachkräftemangel in Zukunft zu verringern. Bremen belegt in dieser Kategorie den letzten Platz.
Wintergerst rief die schwächelnden Länder dazu auf, ihre Digitalisierungsbemühungen zu intensivieren. Die entwickelten Länder werden weiterhin Schwierigkeiten haben, daher ist es sehr wichtig, Gebiete mit schwachen Strukturen zu stärken. In zwei Jahren stellt Bitkom den nächsten regionalen Digitalisierungsindex vor und hofft auf Fortschritte.
Politische Meinung
Reinhard Brandl, Digitalsprecher der Unionsfraktion im Bundestag, kommentierte: „Der Bitkom-Index zeigt einmal mehr, wie wichtig ein starkes Startup-Ökosystem und Investitionen in die Ausbildung von IT-Fachkräften für eine erfolgreiche Digitalisierung sind.“
Maximilian Funke-Kaiser von der FDP stellte fest, dass die digitale Infrastruktur und die digitale Wirtschaft „die größten Herausforderungen im Digitalisierungsprozess in Ostdeutschland“ seien. Allerdings erklärte er, dass sich die östliche Region „im Prozess der Verbesserung befinde“.
Maik Außendorf, digitaler Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, fügte hinzu, dass die geringe Bevölkerungsdichte „in vielen Regionen Ostdeutschlands eine Herausforderung für den Ausbau von Gigabit-Netzen darstellt“.



„Entdecker. Denker. Freiberuflicher Reise-Evangelist. Freundlicher Schöpfer. Kommunikator. Spieler.“



:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/GIQTREYMZRET3DVWXKETBCKJBM.jpg)



